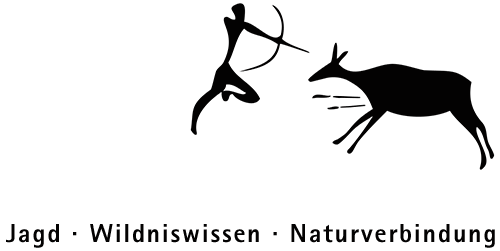Schweinepest und Hirsch-Kampagne
(Veröffentlicht und zur Verfügung gestellt von Frank Christian Heute, www.wildökologie-heute.de)
Jetzt ist sie also da, die Afrikanische Schweinepest (ASP). Und seither erreichen uns täglich neue Hiobsbotschaften aus dem östlichen Brandenburg. Ob über das behördliche Versagen, die Forderungen der Landwirte oder die rasche Ausbreitung. Ziel ist es, so Bundesministerin Klöckner, Deutschland so schnell wie möglich wieder ASP-frei zu machen. Als Vorbild kann Belgien gelten, das die Seuche wahrscheinlich überstanden hat. Vorderste Motivation dabei ist der Schutz der Landwirte aus der Schweineproduktion. Wie immer in landwirtschaftlichen Krisenzeiten wird seitens der Landwirtschaft viel von der Gesellschaft gefordert – insbesondere Geld. Dass aber nur grundsätzliche strukturelle Änderungen der Agrarpolitik eine weitere Intensivierung und Höfesterben verhindern werden, muss jedoch in diesem Zusammenhang gesagt werden.
Der Selbstversorgungsgrad bei Schweinefleisch liegt bei 120 % (statista). Der Schweinefleischkonsum in Deutschland geht seit Jahren zurück, die Produktion nicht. Zur Freude der Agrarindustrie, die weiter „Billigfleisch“ und Schweineschnauzen nach China exportiert, sobald das Embargo wieder aufgehoben sein wird. Möglich machen das Schweinefabriken mit 20.000 Tieren, die bis zur Abfahrt zum Schlachthof zusammengepfercht auf verkoteten Betonspaltenböden stehen. In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Schweinebetriebe um 35% gesunken, die Produktion aber fast auf gleichem Niveau geblieben. Die Betriebe werden immer größer. Mittlerweile gibt es über 500 Betriebe mit mehr als 5000 Schweinen (Bauernzeitung). Diese Art der Landwirtschaftsindustrie verursacht furchtbare Umweltschäden vor unserer Haustür, in dem sie unsere Böden und das Grundwasser belastet und die Biodiversität der Feldflur dezimiert. Deutschland ist – mit den USA – der größte Schweinefleischexporteur der Welt. Muss das sein? Für den Profit einiger weniger Agrarindustrieller? Damit eine Handvoll „Großbauern“ – mitunter Investoren aus dem Ausland – ordentlich verdienen (siehe Maurin in taz), werden kleinere Bauern in den Ruin getrieben, unsere Ressourcen gefährdet und Insekten- und Vogelarten ausgerottet.
Themenwechsel: Diese Woche wurden mal wieder Forderungen von der Deutschen Wildtierstiftung nach mehr Lebensraum für den Rothirsch laut (Rothirschkampagne). Die Idee, dass Hirsche sich neue Areale erobern und mehr Land besiedeln ist zwar romantisch und dürfte vielen Jagdpächtern glänzende Augen bereiten, doch ist sie enorm verklärt. Und wie so oft verzichten diejenigen, die für (noch) mehr Wild plädieren darauf, auch jene Argumente zu nennen, die gegen eine weitere Ausbreitung der Hirsche sprechen.
Die Tierart Rotwild ist in keiner Weise bedroht, im Gegenteil. In den letzten 20 Jahren haben sich Hirsche in Deutschland rasant vermehrt, weil sie – wie andere Schalenwildarten – vom günstigen Klima, der besseren Nahrungsgrundlage und der extensiven Jagd inklusive Fütterung in den ach so kalten Wintern profitieren. Es ist wahrscheinlich, dass es in Deutschland nie mehr Hirsche gab als derzeit. Und dass, obwohl kaum natürlicher Lebensraum des Hirsches in unserer Kulturlandschaft vorhanden ist. Das Rotwild lebte ursprünglich („früher“ bei uns) in offenen und halboffenen Landschaften wie den Auen oder oberhalb der Baumgrenze im Gebirge. Die in Rudeln lebenden Tiere betreiben vorwiegend eine visuelle Feindvermeidung, da die großen Tiere in der offenen Landschaft den Wolf bereits von weitem sehen und rasch reagieren konnten. Solche Landschaften finden wir in Deutschland außerhalb der landwirtschaftlich genutzten Standorte fast nur noch auf wenigen Truppenübungsplätzen. In NRW z.B. dürften überhaupt nur zwei (kleine) Gebiete groß genug sein, um jeweils einer kleinen Rotwildpopulation zu genügen (Senne und Dreiborner Hochfläche/ Eifel). Immerhin kommt Rotwild in unserer intensiv genutzten Kulturlandschaft auf 25% der Fläche vor. Allerdings nicht in seinen typischen Biotopen, sondern fast ausschließlich im Wald. Einem Biotop, das ihnen nicht „liegt“, weil sie hier keine Freiflächen zum Grasen finden und den Wolf nicht kommen sehen.
Kommen Hirsche in Dichten von ein bis drei Tieren pro 100 ha vor, nischen diese sich problemlos auch in das Ökosystem Wald ein. Zumindest sofern parallel nicht auch Muffel-, Dam- oder Sikawild vorkommen und die Rehdichte ebenfalls „passt“. In den meisten Rotwildregionen NRW’s liegt die Dichte aber um zehn Stück pro 100 ha – in manchen Gebieten auch bei 20 oder gar 30 Tieren! Also zehnmal mehr als der Wald „verträgt“. Eine jagdliche Regulation der Hirsche ist in vielen Verbreitungsgebieten offenbar seitens der Hegegemeinschaften nicht gewollt oder man ist handwerklich nicht dazu in der Lage.
Die vielen Hirsche drängen innerhalb ihrer „Bezirke“ nun, um Arealerweiterung bemüht, nach außen. Dort finden sie eine intensiv genutzte Feldflur vor, in der zwar Nahrung vorhanden ist, aber der Druck durch Erholungssuchende und Verkehr viel zu hoch ist. Abgesehen davon verursachen große Hirschrudel auch erhebliche Wildschäden in der Landwirtschaft. Kein Wunder also, dass viele Landwirte einer Ausbreitung der Hirsche skeptisch gegenüber stehen. Ganz abgesehen von den Waldeigentümern. Wer einmal einen (ehemaligen) „Wald“ in einer der Hotspot-Regionen der Hirschwildschäden gesehen hat, wird sich keine Hirsche in seinem Wald wünschen. In manch einem Hirschrevier der Kerngebiete hat das Rotwild Wälder in Baumsteppen verwandelt (vgl. Heute 2016).
Grundsätzlich ist nichts daran auszusetzen, wenn Wildtiere neue Areale besiedeln. Doch aktuell darf sich das Rotwild nicht verbreiten, weil die verantwortlichen Jäger in Hegegemeischaften und die Jagdpächter es nicht schaffen, das Rotwild auf Dichten von ein bis drei pro 100 ha zu regulieren. Offensichtlich gilt in den meisten Regionen weiter das jagdliche Motto: Möglichst viel Wild und viele Trophäenträger. Solange die seit vielen Jahren grassierenden Probleme in etlichen Rotwildbezirken nicht gelöst sind, ist der Ruf nach mehr Lebensraum für das Rotwild nur Effekthascherei, die auf die „Bambi-Mentalität“ eben jener Stadtbevölkerung setzt, die sonst gerne als naturentfremdete Jagdgegner stigmatisiert werden.
Quelle: wildoekologie-heute.de